Konflikte bearbeiten – Eine Anleitung, um Spannungen im Team routiniert zu lösen
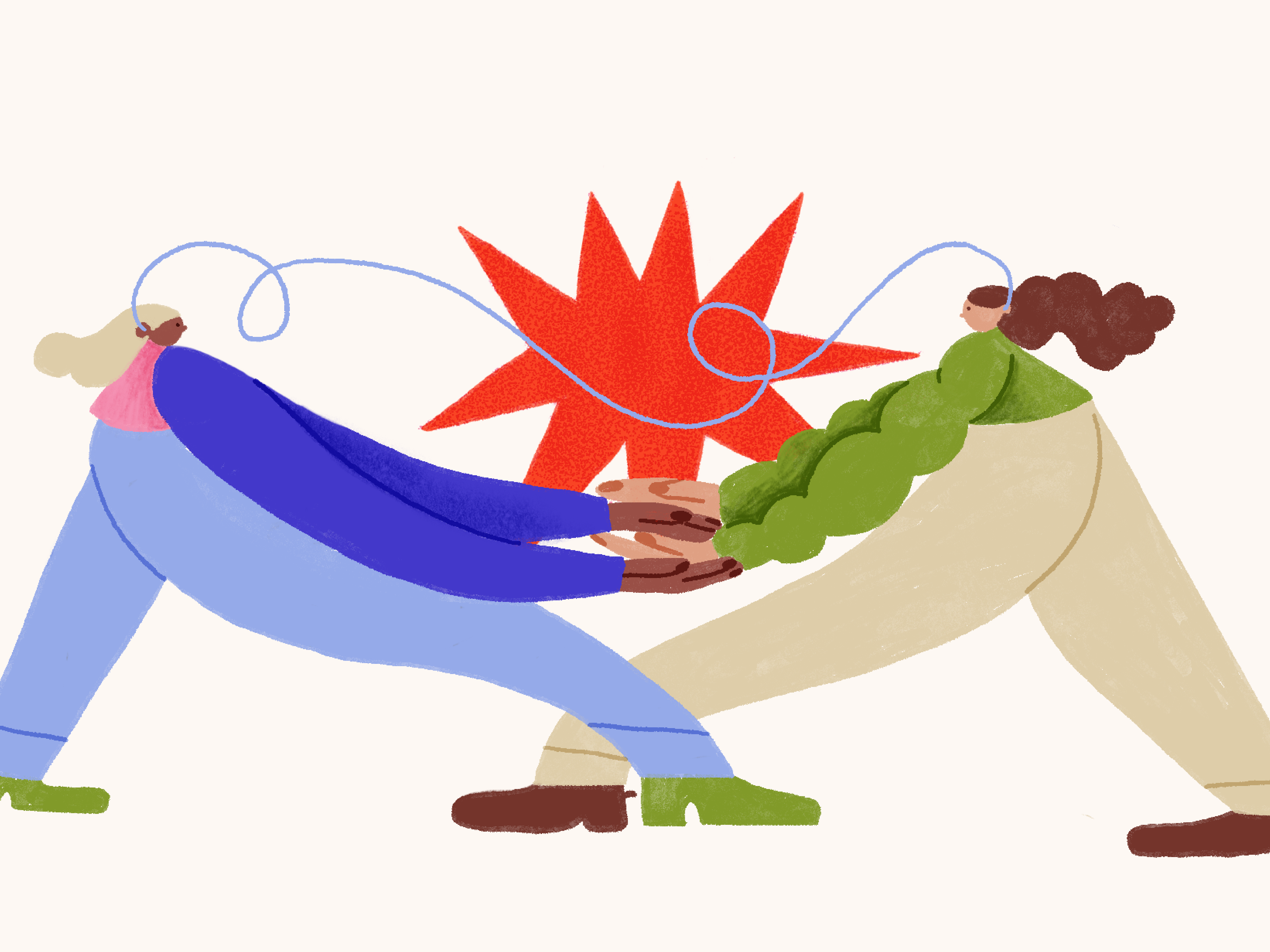
In diesem Artikel teilen wir unsere erste Version einer Konfliktroutine: eine Anleitung, wie man vorgeht, wenn man sich in einem Konflikt befindet.
Es ist leicht, alle teilhaben zu lassen, wenn alles rund läuft. Schwieriger wird es, wenn Spannungen entstehen. Genau dann zeigt sich, ob unsere Werte im Alltag bestehen. Wenn wir uns für eine demokratische, nachhaltige und resiliente Zukunft einsetzen, müssen wir auch intern Räume schaffen, in denen Konflikte angesprochen, ausgehalten und bearbeitet werden können. Konflikte können eine Chance für persönliches Wachstum, bessere Zusammenarbeit und strukturelle Entwicklung sein.
Wir wollen als Organisation lernen und haben den Anspruch, uns stetig zu verbessern. Im Sinne einer offenen Fehlerkultur teilen wir hier, woran wir arbeiten und freuen uns über Feedback, Erfahrungen und Impulse. In unserer Teamumfrage vom Juni 2025 gaben 42 % an, dass Konflikte in unserer Organisation voll oder überwiegend zufriedenstellend gelöst werden, weitere 42 % teilweise und 16 % eher nicht. Gleichzeitig beschrieb die Mehrheit des Kollegiums die Atmosphäre als freundlich, kollegial und hilfsbereit. Es lohnt sich für uns also, gezielt in unsere Konfliktkompetenz zu investieren. Wir denken, dass sich das für alle Organisationen lohnt.
Eine systemische Maßnahme, die wir dazu entwickelt haben, ist unsere Konfliktroutine. Sie soll helfen, Spannungen frühzeitig zu erkennen, konstruktiv und wertebasiert zu handeln und eine sichere Arbeitsatmosphäre zu fördern.
Einsatzbereich der Konfliktroutine
Ein zentraler Gedanke der Routine ist: Konflikte sind nicht schön, aber normal - deswegen auch der Name „Routine“. Sie zielt nicht darauf, alle Konflikte wegzumoderieren. Sie hilft, Spannungen frühzeitig zu erkennen, Verantwortung zu klären und psychologische Sicherheit zu stärken. Die Routine ist ein Rahmen mit definierten Schritten und Rollen, an der man sich orientieren kann, was besonders in emotional aufgeladenen oder unübersichtlichen Situationen hilfreich ist. Wenn sich mindestens eine Konfliktpartei auf die Routine berufen möchte, kann sich die andere Partei einer konstruktiven Auseinandersetzung nicht verweigern. Bei schwerwiegendem Verhalten wie Diskriminierung, Belästigung oder Veruntreuung greifen andere Instrumente wie unser Code of Conduct oder unsere Whistleblowing Policy.
Schritt 1: Konflikt erkennen und in Worte fassen
Der erste Schritt besteht darin, den Konflikt wahrzunehmen – sei es durch ein ungutes Gefühl, wiederkehrende Spannungen oder konkrete Vorfälle. Eine Vertrauensperson kann dabei helfen: Wir haben dezidierte Personen aus Team und im Vorstand, die als Unterstützung in Konfliktfällen zur Verfügung stehen. Eine Vertrauensperson hört zu, hilft beim Einordnen des Konflikts und unterstützt bei der Formulierung der Beobachtungen.
Es kann helfen, zu bestimmen: In welcher Art von Konflikt befinde ich mich?
· Strukturelle Konflikte betreffen Werte, Inhalte, Abläufe, Rollen oder Entscheidungsprozesse, z. B. Meinungsverschiedenheiten über Projektstrategien oder unklare Aufgabenverteilung.
· Individuelle Konflikte beruhen auf zwischenmenschlichen Spannungen, z. B. Kommunikationsstil, Machtverhältnissen oder Erwartungen.
Die Einordnung hilft dabei, Klarheit zu schaffen, auch wenn die Grenzen fließend sind und ein Konflikt oft mehrere Komponenten hat.
Schritt 2: Konflikt ansprechen
Die direkt betroffene Person spricht die andere Partei an, ggf. mit Unterstützung der Vertrauensperson. Ziel ist ein respektvoller Austausch, in dem alle Beteiligten ihr Gesicht wahren und eine Lösung finden können. Dies kann eine Aussprache sein oder die Einführung neuer Prozesse für Zusammenarbeit und Kommunikation sein. Dabei helfen Feedbackregeln: bei sich bleiben, Wirkung beschreiben, konkreten Wunsch formulieren. Wenn eine Lösung gelingt, ist der Prozess abgeschlossen.
Schritt 3: Führungsebene beteiligen
Lässt sich der Konflikt nicht klären, wird die Führungsebene hinzugezogen. Sie ist verantwortlich für den Prozess, kann externe Moderation oder interne Gremien beteiligen, Formate vorschlagen und transparente Kommunikation anstoßen.
Ein sensibler Punkt ist die Balance zwischen Vertraulichkeit und Transparenz. Grundsätzlich gilt: Vertraulichkeit vor Transparenz. Aber manchmal ist Offenheit entlastend, besonders wenn das Team den Konflikt ohnehin mitbekommt. Eine Möglichkeit besteht darin, das Team darüber zu informieren, dass ein Konflikt bearbeitet wird, ohne dabei alle Details zu nennen.
Führungspersonen tragen besondere Verantwortung: Sie sollen Konflikte früh erkennen, neutral moderieren und eine Kultur fördern, in der Kritik angstfrei geäußert werden kann. Sind sie selbst Teil des Konflikts, braucht es externe oder interne Moderation, um Machtasymmetrien auszugleichen.
Schritt 4: Externe Unterstützung holen
Bei komplexen, stark emotional aufgeladenen oder systemischen Konflikten sowie auf Wunsch einer Partei soll ein:e externe:r Mediator:in oder Coach hinzugezogen werden.
Das ist kein Zeichen des Scheiterns, sondern ein professioneller Umgang mit einer herausfordernden Situation.
Externen Support kann man auch früher anregen, etwa wenn die Beteiligten an ihre Grenzen kommen oder Neutralität nicht gewährleistet ist. In unserer Organisation stellen wir finanzielle Mittel für externe Unterstützung bereit, als Bestandteil unserer Konfliktinfrastruktur.
Schritt 5: Konflikt beilegen oder eskalieren
Ein Konflikt gilt als beigelegt, wenn alle Beteiligten zustimmen, dass er beigelegt ist. Gelingt das nicht, wird der Konflikt an die nächsthöhere Führungsebene eskaliert. Konflikte, die über mehrere Ebenen eskalieren, erfordern große Aufmerksamkeit von der Führungsebene und müssen sehr ernst genommen werden. Sie sind mittlerweile so groß, dass sie den Arbeitsalltag von vielen Leuten stark negativ beeinträchtigen. In solchen Fällen kann die externe Unterstützung die zuständigen Führungspersonen beraten. Manche Konflikte können nicht einvernehmlich gelöst werden. Die Routine hilft dann, solche Konflikte zu erkennen und verantwortungsvoll damit umzugehen.
Schritt 6: Learnings ableiten
Alle Beteiligten tragen Verantwortung für ihr Handeln in einem Konflikt. Führungskräfte tragen zusätzlich die Verantwortung für strukturelle Learnings. Was kann die Organisation aus dem Konflikt mitnehmen? Können wir etwas verbessern, damit er sich nicht wiederholt? Es kann sich lohnen, Konflikterfahrungen zu dokumentieren (in einer Form, die unabhängig von den beteiligten Personen ist), um für die Zukunft zu lernen.
Warum das alles?
Eine Konfliktroutine…
… normalisiert Konflikte als etwas, das zum Arbeitsalltag dazugehört.
… gibt Orientierung, klärt Verantwortung und stärkt psychologische Sicherheit.
… unterstützt ein Team dabei, nicht wegzusehen und Konflikte frühzeitig anzusprechen.
… sieht jeden Konflikt als Chance, um sich weiterzuentwickeln, als Mensch und als Organisation.